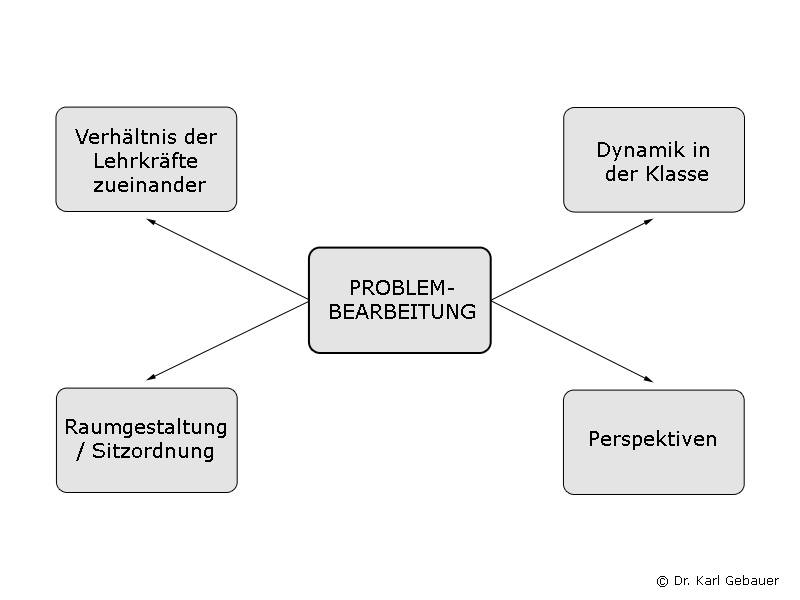Wenn ich unsere Freundschaften an uns vorüberziehen lasse, dann stelle ich fest, dass sie ihren Ursprung in der Kindergartenzeit unserer Söhne, die heute 28 und 22 Jahre alt sind, haben. Unsere Kinder besuchten einen Kindergarten, der aus einer Elterninitiative entstanden war. Es gehörte nicht nur zu den Aufgaben der Eltern, sich mit dem pädagogischen Konzept vertraut zu machen, sondern es waren im Verlauf eines Jahres viele konkrete Aufgaben zu erfüllen wie Kochen, Putzen, Reparaturen am Gebäude, Gestaltung des Außenbereichs, Verwaltungstätigkeiten und anderes mehr. Wir haben auch viele schöne Feste gefeiert. Aus den vielfältigen Begegnungen sind in einigen Fällen Freundschaften entstanden.
Assoziationen über Väter und KITAS
In der Einladung zur Tagung „Väter gefragt – Neue Wege in der Arbeit mit Eltern“ wird festgestellt, dass Elternarbeit faktisch Mütterarbeit sei und dass die Väter meist nur eine Nebenrolle spielten. Es sollen neue Wege beschritten werden, die Interessen der Väter sollen geweckt und ihre Beziehung zu ihren Kindern gestärkt werden. In meinem Beitrag geht es um die Bedeutung des Vaters für die frühkindliche Entwicklung. Mit den folgenden Anregungen an die Leiterinnen von Kindertagesstätten möchte ich die Väter gleich in den Blick rücken.
Von welchem Vater haben sie ein äußeres Bild, eine Vorstellung?
Können sie den Vater seinem Kind zuordnen?
Wenn sie diesen Vater sehen, wie er sein Kind bringt oder abholt, welche Gefühle löst er in mir aus?
Welcher Vater interessiert sich für sein Kind?
Welcher Vater interessiert sich für die Arbeit in der Kita?
Welcher Vater unterstützt die Kita bei konkreten Anlässen?
Welcher Vater löst durch seine Art bei den Erzieherinnen Ärger aus?
Über welchen Vater freuen sie sich richtig?
(Es folgt eine Reflexionsphase mit kurzer Aussprache.)
Vaterschaftskonzepte der Gegenwart
Statistische Erhebungen zeigen, dass sich das Vaterschaftskonzept geändert hat. In einer für Deutschland repräsentativen Studie wird das Vaterschaftskonzept der Gegenwart auf zwei Typen zugespitzt. Danach rechnen sich 66% der Befragten dem Typ „Vater als Erzieher“ und 34 % dem Typ „Vater als Ernährer“ zu. Mit der letzten Bezeichnung ist gemeint, dass sich der Vater eher um die äußern Belange kümmert, während sich der Vater als „Erzieher“ um die gesamte Entwicklung seines Kindes und die Beziehungen innerhalb der familiären Konstellation sorgt. „Es handelt sich also um eine neue soziale Norm, die Vaterschaft neu definieren lässt.“ (Fthenakis/Minsel 2002, S.23)
Eine Studie der evangelischen und katholischen Kirche aus dem Jahr 2009 kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen:
Dem Typ „traditioneller Mann“ werden in der Studie 27 Prozent der Befragten zugeordnet. Beim modernen Männertyp sind es 19 Prozent. Zwischen traditionell und modern siedelt die Studie den „balancierenden Typ“ mit 24 Prozent und als größte Gruppe den nach seiner Rolle „suchenden Mann“ (30 Prozent) an. Sie sind auf dem Weg zu einem inneren Bild, das den Anforderungen der Gegenwart gewachsen ist.
http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2009_03_18_3_maennerstudie.html
19 Prozent der Männer setzen sich mit den Anforderungen in der Familie und in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auseinander. Sie werden als modern angesehen.
Wie entsteht eine zugewandte väterliche Haltung?
Seit einigen Jahren beschäftigt mich die Frage, wie es kommt, dass sich manche Väter emotional ihren Kindern zuwenden und sie in ihrer Entwicklung unterstützen, während sich andere eher desinteressiert zeigen und auf Distanz gehen. Ich wollte erfahren, ob, wie und wodurch es Vätern gelungen ist, ein inneres Vaterbild zu erwerben und zu einem inneren Arbeitsmodell weiter zu entwickeln, das ihnen eine zugewandte väterliche Haltung ermöglichte. Dabei interessierte ich mich besonders für die Ressourcen, die für eine zugewandte Haltung erforderlich sind, und wie diese Ressourcen trotz oft problematisch verlaufender Biographien erworben werden konnten. In Gesprächen mit Vätern im Alter zwischen 37 und 64 Jahren habe ich versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden. Ich stellte jedem Gesprächspartner zwei Grundfragen:
„Wenn sie an ihren Vater denken, welche Situationen, Ereignisse oder Bilder springen dann unmittelbar in ihr Bewusstsein?“ Diese Frage weckte in allen Fällen deutliche Erinnerungen.
„Wenn sie nun an sich selbst als Vater ihres Kindes / ihrer Kinder denken“, so fragte ich meine Interviewpartner, „was fällt ihnen dann spontan ein?“
Auf diese Weise habe ich viele Geschichten von Vätern mit ihren Vätern und mit ihren Kindern gehört, aufgeschrieben und analysiert. Der Blick in die Vergangenheit gibt Aufschluss über das internalisierte Bild vom Vater, der Blick auf die eigenen Kinder lässt das innere Arbeitsmodell sichtbar werden, das das Verhalten eines Vaters im Umgang mit seinen Kindern beeinflusst. (Gebauer 2003)
Die Bedeutung innerer Vaterbilder
Ob und wie sich ein Vater um seine Kinder kümmert, hängt u.a. davon ab, welches innere Bild er selbst von sich als Mann und Vater entwickelt hat. Für eine gelingende Vaterschaft sind Erlebnisse mit einem emotional zugewandten und anregenden Vater wichtig. Beim Fehlen dieser positiven Erfahrungen, kann eine Kompensation über vaterähnliche Personen erfolgen. Diese Aufgabe kann z. B. ein Großvater, ein älterer Bruder oder ein Freund erfüllen (Gebauer 2003, S.100 ff. und S. 178 ff). Das besondere Ereignis der Geburt eines Kindes kann ein entscheidender Schritt zu einer reflektierenden Vaterschaft sein. (Schorn 2003) Damit ein Vater seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann, ist aber auch eine Akzeptanz seiner Rolle durch seine Frau von Bedeutung. Er wird seine Aufgaben als Vater dann besonders gut ausfüllen können, wenn er von seiner Frau nicht nur als Partner sondern auch als Vater des gemeinsamen Kindes gewünscht und akzeptiert wird. In der Umkehrung wird die Mutter ihr Kind eher freigeben können, wenn sie von ihrem Mann als Partnerin akzeptiert und als Mutter des Kindes geschätzt wird.
Wenn Vater, Mutter und Kind positiv aufeinander bezogen sind, kann man von einem gelungenen Triangulierungsprozess sprechen. Auch wenn dieser Prozess in der heutigen Zeit in vielen Familien nicht oder nur begrenzt gelingt, ist dies kein Grund, ihn als unbedeutend anzusehen. Es ist das Prinzip des bedeutsamen Dritten, das unabhängig von der tatsächlichen väterlichen Präsenz von Anfang an seinen Platz in der Mutter-Kind-Beziehung bekommen muss. (Grieser 2002, S.21ff.)
Hilfreich ist es, wenn die Mutter diesen „psychischen Raum“ schon während der Schwangerschaft bereithält, so dass er für das neugeborene Kind innerpsychisch schon vorhanden ist (von Klitzing, 2002, S.13). Der reale Vater muss natürlich bereit und in der Lage sein, diesen von der Mutter eingeräumten Platz auf seine ganz eigene Weise einzunehmen und zu gestalten. Das gelingt nicht immer und nicht zu jeder Zeit.
Einige prägnante Aussagen aus Interviews mit Vätern machen deutlich, wie sehr sie sich, lange bevor sie selbst Vater wurden, nach einem Vater gesehnt haben, der ihnen Anerkennung zuteil werden ließ und Zeit für sie hatte.
„Ich konnte mich anstrengen wie ich wollte, ich habe die Zuneigung meines Vaters nicht erhalten.“ „Ich habe ihn bewundert und mich nach ihm gesehnt.“ „Eigentlich habe ich nie einen Vater gehabt.“ „Was Männer in Beziehungen erleben, das hat als Erfahrung gefehlt.“ „Er hat mich wie verrückt geliebt, konnte es aber nicht zeigen.“ „Mein Vater war da, aber er war nicht erreichbar.“ (Gebauer 2003, S.69ff.)
Im inneren Bild dieser Väter wird eine starke Erwartungshaltung nach Zuwendung und Anerkennung sichtbar. Die Enttäuschung, die in den Aussagen mitschwingt, ist unübersehbar.
Ein Vater von drei Kindern erzählt, er habe immer wieder vergeblich versucht, die Lebendigkeit in seinem Vater zu entdecken. „Das Erste was mir einfällt, wenn ich an meinen Vater denke, das ist der Pfarrer auf der Kanzel. Das ist ein prägendes Bild. Mein Vater war mir mit Badehose am Meer suspekt. In der Kirche war er sehr beeindruckend, sehr klar. In der Familie war er nicht anwesend. Er war auch für Ängste und Sorgen bei mir nicht zuständig. Er war eher so einer, der die familiären Dinge der Frau überließ. Ich habe Orgel gelernt. Das war mein Versuch, an seiner Lebendigkeit teilzuhaben. Ich habe immer wieder versucht, die Lebendigkeit in meinem Vater zu suchen. Was ich auch immer sagte, es gab nur stereotype Anweisungen, es fehlte die emotionale Nähe. Als ich älter wurde und versuchte, mit ihm zu diskutieren, standen sich zwei Menschen mit ihren Meinungen gegenüber. Später habe ich mich von ihm losgesagt. In der Phase der Trennung ist mein Vater gestorben. Ich bin nicht bei der Beerdigung gewesen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir ein einsames Kirchlein gesucht und dort meinem Vater alles entgegengebrüllt, was mir einfiel. Ich habe gebrüllt, gesungen und geweint. Jetzt sind wir quitt, das war anschließend mein Gefühl. Du hast mich allein gelassen, jetzt habe ich dich allein gelassen. Ich habe sehr viel Trauer, aber auch sehr viel Wut gespürt. In mir wuchs der Wunsch, nicht den Weg meines Vaters zu gehen, sondern für mich einen neuen Weg zu suchen.“ (Gebauer 2003, S. 71ff.)
Entwicklung eines Vaterschaftskonzeptes
Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Interviews die Erkenntnis, dass eine unzureichende oder schädliche Vatererfahrung auf unterschiedliche Weise kompensiert werden kann. Dabei scheint für das Gelingen einer zugewandten Väterlichkeit die Orientierung an anderen Männern eine unabdingbare Voraussetzung zu sein. Auf dem Holzweg befinden sich Väter, die sich beim Aufbau und bei der Stabilisierung eines inneren Vaterkonzeptes an Müttern orientieren wollen. Männliche Identität und ein inneres Vaterkonzept brauchen männliche und väterliche Vorbilder.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bedeutung der Mutter/Ehefrau für eine gelingende Vaterschaft unterschätzt werden darf. Eine der neueren Untersuchungen hebt hervor, dass die Ehe-Zufriedenheit der Frau eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. (Herlt 2002, S.602)
Das Konzept einer zugewandten Väterlichkeit hat vor allem dann Chancen, wenn es von der Ehefrau oder Lebenspartnerin unterstützt wird. Die Frau stellt gleichsam für den Vater ihres Kindes einen „psychischen Raum“ (Grieser 2002, S. 21 ff.) bereit. Wenn in ihrer inneren Einstellung eine Wertschätzung des Vaters mitschwingt, dann wirkt sich diese positiv auf die Vater-Kind-Beziehung aus. Natürlich muss der Vater auch bereit sein, diesen Platz einzunehmen und aktiv zu gestalten. Nicht unwesentlich für ein Gelingen der Vaterschaft ist die Qualität der Paarbeziehung. Ein Vater sagt: „Es gibt Mütter und Väter, die sehr auf ihre Kinder achten und auf deren Bedürfnisse eingehen, dabei aber die Paarbeziehungen aufs Spiel setzen. Wenn man auf der Beziehungsebene verunsichert ist, wirkt sich das auf die Beziehungen zu den Kindern aus.“ (Gebauer 2003, S. 75)
Der Vater im familiären und gesellschaftlichen Kontext
In neueren Studien wird der Vater in seinen vielfältigen Beziehungen innerhalb der Familie und im gesellschaftlichen Kontext beschrieben. (Walter 2002)
Als Merkmale für das erfolgreiche Agieren im familiären Kontext werden hervorgehoben:
Kommunikationsfähigkeit in den Situationen des Alltags; Haushaltsbeteiligung; Sensitivität gegenüber den Bedürfnissen der Familienmitglieder; Aktive Freizeitgestaltung mit der Familie; Zufriedenheit der Partnerin; Sorge für den Lebensunterhalt; Achtsamkeit gegenüber der eigenen Persönlichkeit; Interesse an der Entwicklung der Kinder und Aufrechterhaltung von Freundschaften.
Das Vaterbild wird selbstverständlich auch beeinflusst von gesellschaftlichen Erwartungen und familienpolitischen Vorgaben. Es ist z.B. ein großer Unterschied, ob ein Vater die Chance hat, Erziehungszeiten zu nehmen oder nicht. Hier gibt es im Ländervergleich große Unterschiede. Die Situation im Jahr 2003 sah so aus: In Schweden machen 40 % der Väter von der Erziehungszeit Gebrauch, in Österreich 2%, in Deutschland 1,6 %. Während eines Zeitraums von 420 Tagen kann in Schweden einer der Elternteile die Betreuung der Kinder übernehmen und erhält dafür 80 % seines Monatslohnes (Quelle: Der Standard, 20.9.03).
Heute sieht die Situation in Deutschland ganz anders aus: Seit Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 ist die Väterbeteiligung an der Kindererziehung gestärkt worden. 97 Prozent der Familien nutzen das Elterngeld. 25.7 Prozent der Väter beziehen Elterngeld; in Bayern, Sachsen, Berlin und Thüringen liegt die Väterbeteiligung bereits über 30 Prozent. (Studie DIW Berlin 2012)
Konkret geht es bei der Frage nach dem gesellschaftlichen Kontext auch um die Kontakte des Vaters zu Freunden, zur Nachbarschaft, zu Erziehrinnen in den KITAS und zu Lehrkräften in den Schulen. Der Vater muss es ebenso wie die Mutter leisten, die individuellen, familiären und die gesellschaftlichen und beruflichen Ansprüche und Anforderungen unter einen Hut zu bringen.
Zum Stand der Vaterforschung
Erst seit den 70ern Jahren kann man von einer kontinuierlichen und differenzierten Vaterforschung sprechen. Seiffge-Krenke(2002) unterscheidet drei Phasen: In der ersten Phase habe man versucht nachzuweisen, dass die Väter „distante, periphere Figuren in der Kindererziehung“seien. In der zweiten Phase der Vaterforschung habe die Ähnlichkeit zwischen Vater und Mutter im Vordergrund gestanden. Ihre Aktivitäten in Bezug auf das Kind wurden miteinander verglichen. Kennzeichnend für beide Phasen sei, dass der Vater „quantitativ und qualitativ als defizitär im Vergleich zur Mutter eingestuft“ wurde. Allerdings entdeckte man während dieser Phase einige Besonderheiten und Unterschiede im Kontakt zu den Kindern. Väter verhielten sich demnach im Körperkontakt aufregender und risikoreicher mit ihren Kindern. Im Hinblick auf fünfjährige Kinder etwa beobachtete man nach diesen Studien bei den Vätern stärkere körperliche Aktivitäten und ein umfangreicheres Spielverhalten, während bei den Müttern wiederum das umsorgende Element vorherrschte.
Die Frage, worin sich Vater und Mutter in ihren Handlungsweisen und in ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes unterscheiden, wurde erst in jüngerer Zeit gestellt. Bei Vätern war man bisher eher daran interessiert, ob in Bezug auf ihre Töchter eine sexuelle Problematik vorliegen könnte. Das Interesse richtete sich vor allem auf das Thema Missbrauch gegenüber Mädchen und auf aggressive Handlungsweisen von Vätern gegenüber ihren Söhnen. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse, wie sie die Säuglings und Bindungsforschung vorlegen, wird die Frage interessant, ob der Vater nicht ebenso wie die Mutter schon in der frühen Kindheit eine herausragende Bedeutung hat, wenn es zum Beispiel um den Aufbau sicherer Bindungen geht. (Steinhardt, K. / Datler, W. / Gstach 2002)
Viele Väter beteiligen sich an Geburtsvorbereitenden Kursen, sind während der Geburt ihres Kindes anwesend und nehmen unmittelbar körperlichen Kontakt zu ihm auf. In der Folge wickeln und pflegen diese Väter ihre Kinder, nehmen sie auf den Arm und sind auf diese Weise wie die Mutter eine nahe Bezugsperson. In einer vertrauensvollen Beziehung erlebt das Kind, dass es neben der Mutter noch eine weitere Person gibt, die sich anders anfühlt, deren Stimme anders klingt, die aber dennoch Geborgenheit vermittelt. Eine so beginnende emotionale Bindung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. (Scheer/Wilken 2002, S.182 ff) Aus der Säuglingsforschung ist bekannt, dass ein Kind schon in den ersten Wochen eine Beziehung zu mehren Personen aufbauen kann. Eine große Bedeutung des Vaters für die Identitätsentwicklung und die Bindungssicherheit seines Kindes wird daher bereits für diese Phase angenommen.
Der Spannungsbogen der Vaterforschung reicht von einer weitgehenden Ignoranz des Vaters bis hin zu einem positiven, unterstützenden Vater. Auch seine wesentliche Rolle als Dritter im Beziehungsgefüge (Mutter – Kind – Vater) wird zunehmend gewürdigt (von Klitzing 2002 b, S.94 ff.). Die Aufgabe des Vaters liegt über weite Strecken vor allem darin, der Verschmelzung zwischen Mutter und Kind etwas entgegen zusetzen. So kann er am ehesten zur Autonomieentwicklung seines Kindes in den ersten Lebensjahren beitragen (Petri 2002, S.5 ff.). Der Psychoanalytiker Peter Blos (1990) hat die Vater-Sohn-Beziehung bis ins Erwachsenenalter beschrieben und spezifische Verhaltensweisen des Vaters hervorgehoben: zum einen geht es darum, zu seinen Kindern eine angemessene Beziehung herzustellen, und zum anderen gilt es auch eine entsprechende Paarbeziehung zu leben. So kann ein Kind erfahren, dass es in einem Beziehungssystem aufwächst, dem mindestens drei Personen angehören. Es erkennt im Verlauf seiner Entwicklung, dass es zu Vater und Mutter eine Beziehung hat und dass es darüber hinaus eine Dreierbeziehung gibt. Im ersten Fall spricht man von einer dyadischen und im zweiten Fall von einer triadischen Beziehung. Bei aller Fürsorglichkeit vor allem des frühen Vaters für den Sohn und der Wahrnehmung von Ähnlichkeit ist es dennoch wichtig, sich um Differenz zu kümmern und die Bedeutung des Dritten, in diesem Fall die Mutter, zu beachten.
Zusammenfassend hebt Inge Seiffge-Krenke hervor, dass der Vater in der Erziehung einen besonderen Beitrag hinsichtlich der Individuation leiste, der den Beitrag der Mutter ergänze und komplettiere. „Er muss seine Rolle als Vater übernehmen und nicht zur zweiten Mutter werden. Für alle diejenigen Kinder und Jugendlichen jedoch, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht mit ihren Vätern zusammenleben, ist, auch wenn diese nur einen kleinen Teil ihrer Zeit zur Verfügung stellen können, die Regelmäßigkeit dieses Arrangements und die Einbeziehung in den Alltag notwendig, um die gefährliche Idealisierung von Vätern zu vermeiden.“ (Seiffge-Krenke 2002, S.31) Für eine gute Entwicklung sind unterschiedliche Akzentsetzung durch Mutter und Vater wichtig. Die Ablösung in der Adoleszenz kann dann gut gelingen, wenn eine Beziehung zu beiden Eltern besteht. Je mehr ein Kind mit der Realität auch außerhalb der Familie konfrontiert wird, desto stärker gewinnt der Vater als Sicherheit bietende Instanz an Bedeutung.
Der Spannungsbogen der Vaterforschung reicht also von einer weitgehenden Ignoranz des Vaters bis hin zu einem positiven, unterstützenden Vater.
Was Kinder und Jugendliche so über ihre Väter sagen
Lange erschienen die Väter als Randfiguren in der Kindererziehung. Das drückt sich immer noch in Äußerungen von Kindern und Jugendlichen aus:
„Mein Vater? Ich weiß nicht. Er ist eigentlich gar nicht. Er ist nichts. Er möchte es immer allen recht machen. Hat keine Autorität.“
„Ich bin 16, lebe mit meiner Mutter, vermisse meinen Vater nicht.“
„Mein Vater ist mein Erzeuger. Wir kennen uns nicht besonders gut. In der Erziehung spielt er keine Rolle. Wir verbringen die Wochenenden miteinander.“
„Mein Vater hat uns verlassen. Vielleicht lag es daran, dass sein Vater auch gegangen ist, als er ein Jahr alt war.“
(Ausschnitte aus einer Fernsehsendung vom, in der Jugendliche über ihr Verhältnis zu ihren Eltern befragt wurden.10.2.03, ARTE)
In diesen Äußerungen erscheint der Vater als merkwürdiger – vielleicht sogar als ein verantwortungsloser Geselle. Aber bei den Vätern ist etwas in Bewegung geraten. Neuere Forschungsergebnisse zum Selbstverständnis von Vätern (Fthenakis/Minsel 2002, Walter 2002) geben Anlass zu einer optimistischen Sichtweise.
Vor diesem Hintergrund hören sich Äußerungen von Schülerinnen und Schülen zum Beispiel so an:
Insa, eine 16-jährige Schülerin erzählt: „Wenn es regnete, dann saß ich oft mit meinem Papa und meinem Onkel am Tisch und wir bauten gemeinsam mit Legostseinen. Ich sehe die Situation heute noch vor mir. Die beiden haben sich gefreut. Ich glaube, sie haben sich noch einmal als Kinder erlebt. Mit Barbis habe ich auch gespielt.“
„Mit meinen Geschwistern und meinem Vater haben wir nach Weihnachten mit Lego gespielt. Das Eigenartige dabei ist, dass wir gebaut und gebaut haben. Manchmal hatten wir das ganze Zimmer zugebaut. Da gab es einen Bereich für Eskimos und dann war da eine große Eisenbahnanlage. Und wenn wir damit fertig waren, dann war das Projekt auch zu Ende. Gespielt haben wir dann nicht mehr damit. Das Entscheidende bestand in der Konstruktion.“ (Jakob 16 Jahre)
Leo (15 Jahre) erzählt: „Ich habe viel von meinem Vater gelernt. Eigentlich hat er mir alles beigebracht. Die ersten sechs Schuljahre haben mich eher negativ geprägt. Ich hatte merkwürdige Lehrerinnen und Lehrer. Es galt nur ihre Meinung. Sie haben mit vermittelt, dass nur sie es sind, die über Wissen verfügen. Vor allem aber haben sie sehr deutlich gemacht, wer das Sagen hatte. Ich habe sie nicht gemocht. (…)
Meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Auch dann, wenn ich keine Lust hatte, zum Beispiel Klavier zu spielen, hat mich mein Vater angehalten, dennoch zu üben. Meine Mutter spielte eher eine Rolle, wenn es Probleme gab. Und dann war da noch mein Großvater. Mit ihm war ich oft im Wald unterwegs. Er hat mir viel über Pflanzen und Tiere erzählt. Mit ihm zusammen habe ich auch Gedichte gelernt. Auch aus seiner Kindheit hat er viel erzählt. Auch mein Vater hat mir viel aus seiner Kindheit erzählt.“ (Gebauer 2004)
Das väterliche Beziehungsangebot ist wichtig
Aus wissenschaftlicher Sicht wird der Beziehungsgestaltung eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Hirnforscher sehen in der Qualität der Beziehung die Grundlage für eine gelingende Entwicklung. Die sich herausbildenden Muster der neuronalen Verbindungen sind ein Spiegelbild der Gefühlsreaktionen der Bindungspersonen.
Kinder brauchen daher Eltern, Erzieherinnen und Lehrpersonen, die Geborgenheit vermitteln, Interesse zeigen, Anregungen geben, Regeln erklären, bei Konflikten helfen, Eigenaktivitäten zulassen und sich an der individuellen Entwicklung eines Kindes freuen. Gelingendes Lernen findet in erster Linie in einer anregenden, wertschätzenden Atmosphäre statt – sei es in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule.
Zuwendung, Anerkennung, emotionale Achtsamkeit, Anregungen, Geborgenheit, Beziehungsvorbild sind grundlegende Merkmale eines zugewandten Vaters im gesamten Entwicklungsprozess. In den ersten Lebensjahren besteht seine Aufgabe vor allem darin, körperliche Nähe und ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Er ergänzt und erweitert die wichtige Muter-Kind-Beziehung und ist für sein Kind der „bedeutsame Dritte.“ Seine Aufgabe in der frühen Kindheit liegt über weite Strecken vor allem darin, der Verschmelzung zwischen Mutter und Kind etwas entgegen zu setzen. Neben der dyadischen Beziehung zur Mutter kann das Kind auch eine Zweierbeziehung zum Vater erleben. So kann er zur Autonomieentwicklung seines Kindes beitragen. In den folgenden Lebensjahren kommt es vor allem auf gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen an. Wenn ein Vater mit seinem Kind in der Natur auf Entdeckungsreise geht, es bei seinen vielfältigen Lernschritten wie Dreirad-, Roller-, Fahrradfahren und beim Schwimmen unterstützt, dann wird er als Vorbild erlebt Auf diese Weise wird eine tragfähige Beziehung aufgebaut, die eine wichtige Voraussetzung für den später einsetzenden Ablösungsprozess bildet.
Spiel und Gehirnentwicklung
Das Haupterfahrungsfeld für Babys und Kinder ist das Spiel. Im Spiel setzt sich ein Kind durch permanente Gestaltung mit sich und der Welt auseinander. Seine Selbstentwicklung basiert auf unendlich vielen Interaktionserfahrungen mit anderen Menschen in der jeweiligen Umwelt. Ein spieleinfühlfähiger Vater trägt nicht nur zu einer stabilen Bindung und der Erfahrung von Geborgenheit bei, er gibt seinem Kind über vielfältige Anregungen die Möglichkeit, die damit verbunden Erfahrungen in inneren Bildern, Geschichten und Erzählungen anzulegen, zu speichern. Somit trägt er entscheidend zur kognitiven Entwicklung bei, denn unser Gehirn enthält nicht Erinnerungen an einzelne Objekte, sondern an die emotionale Einbettung dieser Objekte in eine als bedeutsam erlebte Situation. Es sind die Szenen, die Erzählungen, die persönlichen Erlebnisse, die als erste Repräsentanten so etwa wie eine Grund-Matrix ausbilden, auf der sich später abstrakte Gedanken und Erinnerungen abbilden. Hier werden die Grundlagen für die später so wichtige intrinsische Motivation gelegt. (Gebauer/Hüther 2002, S. 14 ff. ).
Idealisierung und Entidealisierung des Vaters
Der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, die Phase der Adoleszenz, ist eine Zeitspanne, in der das innere Bild vom Vater besonders intensiv überprüft und gegebenenfalls verändert wird. Gelingt der Prozess der Revision des inneren Vaterbildes während und auch nach dieser Phase, man spricht auch von einer Entidealisierung, dann führt dies zu größerer Selbständigkeit, verbunden mit mehr Verantwortungsbereitschaft für die eigene Identitätsentwicklung.
Eine Idealisierung des Vaters entwickelt sich aus konkreten Erfahrungen mit dem Vater und den Wunschfantasien, wie der Vater sein sollte. Die so idealisierten Seiten des Vaters werden im Verlauf der Adoleszenz zunehmend durch die Erfahrung mit dem realen Vater infrage gestellt. Es sind jene positiven Erfahrungen, die dem Heranwachsenden bisher eine innere Orientierung boten. Auch das eigene Selbst wird zunehmend realistisch wahrgenommen. Es werden sowohl beim Vater als auch beim Jugendlichen die Stärken und Schwächen sichtbar und wahrnehmbar. Der zuvor als stark und mächtig erlebte Vater „schrumpft“ immer mehr zusammen.
Innerhalb dieser oft sehr heftig verlaufenden Veränderungsprozesse kommt der Mutter eine vermittelnde Funktion zu. Das gilt nicht weniger für die Auseinandersetzung der Mutter mit den Kindern. Kommt es hier zu unlösbar scheinenden Verstrickungen, dann ist die vermittelnde Funktion des Vaters gefragt. Die Konflikte, die gerade währen der Phase der Pubertät sehr heftig sein können, sollten immer wieder Gegenstand gemeinsamer Reflexionen sein. Gelingen solche Gespräche, dann müssen weder Vater noch Mutter in der Folge von ihren Kinder erniedrigt oder erhöht werden, sie können realistisch wahrgenommen werden. Diese Reflexionsprozesse stellen für die Heranwachsenden einen wichtigen Orientierungsrahmen dar.
Sensitivität des Vaters
Neuere Studien zeigen, dass es vor allem die emotionalen Fähigkeiten eines Vaters sind, die eine gelingende Vaterschaft ermöglichen. Eine zugewandte väterliche Haltung zeigt sich vor allem darin, dass sich ein Vater in die Wünsche und Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder einfühlen und diese auch in seinem Handeln berücksichtigen kann. In diesem Zusammenhang ist seine Kommunikationsfähigkeit hinsichtlich der vielen Entscheidungen, die das alltägliche Leben verlangt, gefragt.
Die Zufriedenheit der Partnerin lässt Väterlichkeit besonders wirksam werden
Das Konzept einer zugewandten Väterlichkeit hat vor allem dann Chancen, wenn es von der Ehefrau oder Lebenspartnerin unterstützt wird. Für die unterschiedlichen Arrangements einer gelingenden Lebensführung, bei der die Kinder in ihrer Entwicklung gestärkt werden, ist also ein hohes Maß an Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit erforderlich. Viele Väter sind nach neueren Untersuchungen dazu bereit und fähig. (Herlt 2002, Kudera 2002)
Ein Vater sagt: „Es gibt Mütter und Väter, die sehr auf ihre Kinder achten und auf deren Bedürfnisse eingehen, dabei aber die Paarbeziehungen aufs Spiel setzen. … Wenn man auf der Beziehungsebene verunsichert ist, wirkt sich das auf die Beziehungen zu den Kindern aus. Und umgekehrt darf man sich nicht von den Aufgaben, die man den Kindern gegenüber hat, auffressen lassen. Das ist natürlich nicht einfach. Manchmal reicht die Kraft nicht, oder man hat den Eindruck, dass man total überfordert ist. Wenn man zum Beispiel die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ein Kind krank ist. Später bekommt man die Energie von den Kindern zurück. So erlebe ich das jedenfalls.“ Gebauer 2003, S. 75)
Desinteresse und Gewalt
Über weite Strecken der Entwicklung geht es bei den Kindern um Entdeckungen, um das Wahrnehmen und Genießen der eigenen Stärke, des eigenen Könnens. Kinder lernen gern von ihrem Vater und schätzen ihn als Vorbild, wenn er ihnen Interesse entgegenbringt und auch Zeit für sie hat. Steht der Vater nicht zur Verfügung, so kommt es bei manchen Kindern zu Enttäuschungsaggression. Es besteht die Gefahr, dass er selbst durch sein Desinteresse zum Auslöser von Aggressionen wird. Der Vater fehlt als Anreger und als Identifikationsmodell. Er fehlt vor allem als naher und zugewandter Vater, der durch sein Verhalten in Konflikten ein Vorbild dafür sein könnte, wie man in Konflikten mit aggressiven Gefühlen umgehen kann. In der Triade von Mutter, Vater und Kind kann am ehesten erlebt und gelernt werden, dass es für viele Alltagsprobleme nicht nur Lösungen gibt, sondern dass auch Alternativen zu den jeweiligen Ergebnissen denkbar wären. Das setzt Umgangsformen voraus, die sich durch Sensitivität, Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit auszeichnen. Hier liegt für ein Kind die große Chance innerhalb seines Entwicklungsprozesses nicht nur oberflächlich erwünschte Verhaltensweisen auszubilden, sondern einen inneren Lebens- und Erlebensraum zu entwickeln.
Der Ablösungsprozess gelingt, wenn es eine tragfähige Bindung gab
Der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, die Phase der Adoleszenz, ist eine Zeitspanne, in der das innere Bild vom Vater besonders intensiv überprüft und gegebenenfalls verändert wird. Es ist eine Zeitphase, in der heftige Auseinandersetzungen stattfinden. Gelingt der Prozess der Revision des inneren Bildes vom Vater während und auch nach dieser Phase, dann führt dies zu größerer Selbständigkeit, verbunden mit mehr Verantwortungsbereitschaft für die eigene Identitätsentwicklung. Innerhalb dieses Prozesses wird der Vater „entidealisiert“ und das heranwachsende Kind lernt es innerhalb dieses Prozesses mehr und mehr den Vater und schließlich sich selbst realistisch wahrzunehmen.
Für Väter und Mütter ist diese Phase nicht einfach. Einerseits sollen sie ihren Kindern Sicherheit geben, ihnen beim Übergang zum Beruf helfen und mit ihnen Perspektiven eröffnen, andererseits ist die eigene Situation oft durch große Unsicherheiten geprägt.
Sexuelle Identitätsentwicklung
In dieser Phase werden auch die bisherigen Erfahrungen mit der sexuellen Identitätsbildung aktuell. Die neuen Herausforderungen, die nun an Jungen und Mädchen gestellt werden, können u.a. dann besser angenommen und bewältigt werden, wenn es positive verinnerlichte Erfahrungen über das Mann- und Frausein gibt.
Bereits in der frühen Beziehungen zu Vater und Mutter liegen die Anfänge der sexuellen Identitätsbildung. Vater und Mutter können von dem Kind in ihrem Anderssein, in ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit erfahren werden. Die Erfahrung beider Modi scheint unabdingbar für die psychische Entwicklung zu sein. So wichtig eine sichere Bindung zwischen Mutter und Sohn ist, so muss dieser sich im Verlauf seiner Entwicklung vom realen Geschlecht der Mutter ent-identifizieren. Der kleine Junge hat bei einem zugewandten Vater, schon früh ein leibhaftiges männliches Vorbild hinsichtlich seiner Geschlechtsidentität. Der Erkenntnisprozess, nicht so zu sein wie die Mutter und der damit verbundene Schmerz kann gemildert werden, wenn der Junge von Anfang an körperliche und emotionale Erlebnisse mit seinem Vater hat.
Es ist nicht Aufgabe des Vaters, zweite Mutter zu sein.
Im Kindergarten und in der Grundschule wären Männer als Erzieher und Lehrer für die Identitätsentwickelung gerade der Jungen besonders wichtig. Über eine emotional tragende Beziehungserfahrung ist eine positive Identifizierung mit dem Vater möglich. In der Phase der Adoleszenz ist es wichtig, dass z.B. ein Vater seinem Sohn und auch seiner Tochter signalisiert: „Es ist schön zu sehen, wie ihr euch entwickelt.“ Viele anerkennende Komplimente sind denkbar. Dabei sollte jetzt klar sein, dass die Gleichaltrigen-Gruppe in dieser Phase eine große Bedeutung einnimmt. Aber Vater und Mutter haben nach wie vor wichtige Funktionen in den anstehenden Klärungsprozessen.
Während der gesamten Entwicklung geht es um das Ausloten der Freiräume und Grenzen. Die Bedeutung des Vaters, liegt u.a. darin Nähe und Sicherheit zu ermöglichen, aber auch Grenzen zu setzen. Gelingen solche Prozesse, dann entstehen im inneren Erlebnisraum des Kindes Bilder eines zugewandten Vaters.
Ambivalenz und Kohärenzerfahrungen
Im Verlauf seiner Entwicklung wird ein Kind bei seinen Strebungen nach Wohlbefinden und Unabhängigkeit Vater und Mutter als „böse“ und „gut“ erleben. Für die Eltern ist damit die Aufgabe verbunden, die Gefühle ihres Kindes nicht abzuwehren, sondern sie als elementare Erlebnisweisen in ihre Kommunikation einzubeziehen. Dabei ist die Erfahrung von „sprachlicher Kohärenz“ entscheidend. Das Gesagte muss mit dem Erlebten übereinstimmen. Wird so über Gefühle kommuniziert dann kommt es zu einer Integration von „guten“ und „bösen“ Beziehungsanteilen. Es entsteht ein Netz von inneren Repräsentanten bzw. inneren Bildern. Hier wird die wichtige Erfahrung gemacht, dass kein Mensch „nur gut“ oder „nur böse“ ist. Erleben Kinder, dass im Verlauf von Konflikten Gefühle ausgedrückt und benannt werden, dann haben sie die Chance, eine eigene Gefühlssicherheit zu erwerben. Sie erleben auch, dass sich Gefühle verändern. Es entstehen Modelle davon, wie Konflikte unter Einbeziehung der Emotionen geklärt werden und so auch anders als nur mit Gewalt gelöst werden können. Diese Modelle stehen dann im Kindergarten und später in der Schule als innere Orientierungen zur Verfügung.
Identitätsentwicklung „ohne Vater“
Für alle Kinder und Jugendlichen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit ihren Vätern zusammenleben, ist die Regelmäßigkeit des Kontaktes mit ihm und die Einbeziehung in den Alltag wichtig.
Steht kein Vater als nahe Person zur Verfügung, mit dem sich ein Kind identifizieren kann, dann kann dies den unbedingt erforderlichen Ablösungsprozess von der Mutter erschweren, eng verbunden damit ist die sexuelle Identitätsentwicklung. Grundlage für das spätere Vatersein ist die Entwicklung einer männlichen Identität. Diese ist nur möglich über Erfahrungen mit männlichen Vorbildern. Scheitert dieser Versuch, dann kann der Sohn ein Leben lang auf die enge Beziehung zur Mutter fixiert bleiben und sich auf eine unendliche Reise der Sehnsucht nach dem Vater begeben. Bleibt es bei einer Orientierung an der Weiblichkeit, dann ist eine Abgrenzung nur schwer möglich. Die Ausbildung einer männlichen und später auch einer väterlichen Identität wird erschwert oder verhindert. Es besteht auch die Gefahr, dass ein Sohn von der Mutter als Ersatzpartner missbraucht wird. Lässt sich die Mutter von ihrem Sohn verführen, dann wird das Inzestverbot verletzt. Damit gehen entscheidende Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung verloren. Lehnt die Mutter ihren Partner/Ehemann als Vater für ihr Kind ab, dann erschwert sie ebenfalls den Aufbau der männlichen Identität ihres Sohnes. Der Vater erscheint seinem Kind als blasser Repräsentant des Männlichen und wird oft auch so verinnerlicht. Eine Identifikation mit einem Vater, der über bestimmte Zeiträume abwesend ist, ist dann möglich, wenn sein Bild in der Vorstellung der Mutter positiv besetzt ist.
Nicht selten kommt es vor, dass der Vater anwesend, aber emotional abwesend ist. Ein solcher Vater kann den Entwicklungsprozess seiner Kinder enorm dadurch erschweren, dass er die Entwicklung eines inneren Raumes, in dem ein lebendiger Vater als inneres Bild aufgebaut werden muss, blockiert (vgl. Gebauer 2003, S.150 ff. und S. 238 ff.). Damit sind alle Prozesse beeinträchtigt, die zur Entfaltung der Identität erforderlich sind:
- Es mangelt an der Erfahrung von Nähe und Geborgenheit; sichere emotionale Bindungen können nur schwer entwickelt werden.
- Eine Identifizierung mit dem Vater erscheint nicht erstrebenswert, somit entfällt die Chance einer Idealisierung des Vaters.
- Eine innere Orientierung in schwierigen Situationen an einem verlässlichen Vaterbild ist nicht möglich.
- In einer solchen Situation können auch keine Erfahrungen für eine positive sexuelle Identitätsentwicklung gemacht werden.
- Eine Modulation der Gefühle, vor allem der Umgang mit aggressiven Impulsen, wird erschwert. Der Vater entfällt als Helfer beim Umgang mit Gefühlen.
- Oft richten sich die Aggressionen über Projektion und Inszenierung nach außen, weil der Aufbau eines inneren psychischen Raumes, in dem die unterschiedlichen Gefühle bearbeitet werden können, wegen Unfähigkeit oder Desinteresse auf Seiten des Vaters nicht ausgebildet werden konnte.
Zusammenfassung und Ausblick:
Die Aufgabe des Vaters besteht in den ersten Lebensjahren vor allem darin, körperliche Nähe und ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Er ergänzt die wichtige Muter-Kind-Beziehung nicht nur in der Pflege, sondern vor allem auch im Spiel mit seinem Kind. In einer vertrauensvollen Beziehung erlebt das Kind, dass es neben der Mutter noch eine weitere Person gibt, die sich anders anfühlt, deren Stimme anders klingt, die aber dennoch Geborgenheit vermittelt. Der Vater ist für sein Kind der „bedeutsame Dritte.“ Er trägt so zur Autonomieentwicklung bei.
In den folgenden Lebensjahren kommt es vor allem auf gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen an. Wenn ein Vater mit seinem Kind in der Natur auf Entdeckungsreise geht, es bei seinen vielfältigen Lernschritten wie Dreirad-, Roller-, Fahrradfahren und beim Schwimmen unterstützt, dann wird er als Vorbild erlebt. So wird eine tragfähige Beziehung aufgebaut, die für den später einsetzenden Ablösungsprozess benötigt wird.
Der „moderne Vater“ zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass er sich in die Wünsche und Bedürfnisse der anderen familiären Mitglieder einfühlen kann. Viele Väter sind nach neueren Untersuchungen dazu bereit und fähig. Zuwendung, Anerkennung, emotionale Achtsamkeit, Anregungen, Geborgenheit, Beziehungsvorbild sind grundlegende Merkmale eines zugewandten Vaters im gesamten Entwicklungsprozess. Am ehesten werden sie bei ihrem Bemühen von den Gegebenheiten der Arbeitsverhältnisse eingeschränkt. Hier sind allerdings positive Veränderungen zu erkennen.
Das Konzept einer zugewandten Väterlichkeit hat vor allem dann Chancen, wenn es von der Ehefrau oder Lebenspartnerin unterstützt wird. Für alle Kinder und Jugendlichen, die nicht mit ihrem Vater zusammenleben, ist die Regelmäßigkeit des Kontaktes notwendig.
Hinsichtlich der Frage, wie Erzieherinnen bei Vätern Interesse für die Arbeit in der Kita wecken können, seien folgende Anregungen gegeben:
- Väter ansprechen, die bereits Interesse zeigen und zur Mitarbeit bereit sind,
- Väter hinsichtlich ihrer Wünsche und Möglichkeiten befragen,
- Einen Elternabend gestalten, bei dem die Facetten des Freien Spiels konkret erfahren werden,
- Im Rahmen von Elternabenden die Bedeutung der Beziehung thematisieren,
- Mit Müttern und Vätern über ihre Erziehungskonzepte sprechen,
- Gespräche über die individuelle Entwicklung eines Kindes führen.
Literatur:
Bauer, J. (2005): Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen. Hoffmann und Campe, Hamburg
Bauer, J. (2006): Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Hoffmann und Campe, Hamburg
Dornes, M. (2000): Die emotionale Welt des Kindes. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt a./M.
Erdheim Mario (2002): Ethnopsychoanalytische Aspekte der Adoleszenz – Adoleszenz und Omnipotenz, in: Psychotherapie im Dialog, Nr. 4
Franz, M. (2002): Wenn der Vater fehlt. Epidemiologische Befunde zur Bedeutung früher Abwesenheit des Vaters für die psychische Gesundheit im späteren Leben. In: Frühe Kindheit. Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind, Heft 3
Fthenakis, W. (1988): Väter. Band 1: Zur Psychologie der Vater-Kind-Beziehung. Deutscher Taschenbuchverlag, München
Fthenakis, W. (1988): Väter. Band 2: Väter in unterschiedlichen Familienstrukturen. Deutscher Taschenbuchverlag, München
Fthenakis, W. (2002): Die Rolle des Vaters in der Familie. Eine repräsentative Studie über Vaterschaft in Deutschland. In: Frühe Kindheit. Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind, Heft 3
Gebauer, K. (2001): Kinder auf der Suche nach Geborgenheit in einer Welt brüchiger Beziehungen. In: Gebauer, K. / Hüther, G. : Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Erziehung. Walter, Düsseldorf
Gebauer K. / Hüther, G. (Hrsg.) (2001): Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung. Walter, Düsseldorf
Gebauer, K. / Hüther, G. (Hrsg.)(2002): Kinder suchen Orientierung. Anregungen für eine sinn-stiftende Erziehung. Walter, Düsseldorf
Gebauer, K. / Hüther, G. (Hrsg.)(2003): Kinder brauchen Spielräume. Perspektiven für eine kreative Erziehung.
Gebauer, K. (2003): Väter gesucht. 16 exemplarische Geschichten. Walter, Düsseldorf
Gebauer, Karl: Die Bedeutung des Vaters für die Identitätsentwicklung. In: Gebauer, K. / Hüther, G. (Hg.) (2004): Kinder brauchen Vertrauen. Erfolgreiches Lernen durch starke Beziehungen. Walter, Düsseldorf
Gebauer, K. (2011): Gefühle erkennen –sich in andere einfühlen. Kindheitsmuster Empathie. Ein Bilderbuch. Beltz, Weinheim
Gebhard, Ulrich (2003): Die Vertrautheit der Welt. Zur Bedeutung kindlicher Naturbeziehungen. In: Gebauer, K. / Hüther, G. :Kinder brauchen Spielräume. Perspektiven für eine kreative Erziehung. Walter, Düsseldorf
Grieser, J. (2000): Der phantasierte Vater. Zur Entstehung und Funktion des Vaterbildes beim Sohn. Edition diskord, Tübingen
Grossmann, K.E. /Grossmann K. (2001): Das eingeschränkte Leben. Folgen mangelnder und traumatischer Bindungserfahrungen. In: Gebauer, K. /Hüther, G.: Kinder brauchen Wurzeln, Walter, Düsseldorf
Haug-Schnabel, G. (2002): Erziehen – durch zugewandte und kompetente Begleitung zum selbsttätigen Erkennen und Handeln anleiten. In: Gebauer, K. / Hüther, G.: Kinder brauchen Spielräume. Perspektiven für eine kreative Erziehung. Walter, Düsseldorf
Heinz, W. (2002)(Hg.): Männer als Väter. Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie. Psychosozial-Verlag, Gießen
Herlt, A. (2002): Ressourcen der Vaterrolle. Familiale Bedingungen der Vater-Kind-Beziehung. In: Walter, H. (Hg.): Männer als Väter. Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie. Gießen
Keppler, A. / Stöcker, K. / Grossmann, K.E. / Grossman, K. /Winter, M. (2002): Zwischenmenschliche Beziehungen befriedigend gestalten. Kindliche Bindungserfahrungen und Repräsentationen von Partnerschaften im jungen Erwachsenenalter. In: von Salisch, M. (Hrsg.): Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend. Kohlhammer, Stuttgart
Kernberg, O.F. (1988): Innere Welt und äußere Realität. Anwendung der Objektbeziehungstheorie. Verlag Internationale Psychoanalyse. München, Wien
Kudera, W. (2002): Neue Väter, neue Mütter – neue Arrangements der Lebensführung. In: Walter, H. (Hg.): Männer als Väter. Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie. Gießen
Mitscherlich, A. (2003): Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie. Beltz, Weinheim
LeDoux, J. (1998): Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. Hanser, München
Papousek, M. (2001): Die Rolle des Spiels für die Selbstentwicklung des Kindes. In: Frühe Kindheit, Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind, Heft 4
Papousek, M. (2003): Gefährdungen des Spiels in der frühen Kindheit: Klinische Beobachtungen, Entstehungsbedingungen und präventive Hilfen. In: Papousek, M / von Gontard, A. (Hrsg.)(2003): Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit. Pfeiffer bei Klett Cotta, Stuttgart
Papousek, M. (2003 b): Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit. In: Gebauer, K. / Hüther, G. Kinder brauchen Spielräume. Ein Plädoyer für Kreativität in der Erziehung. Walter, Düsseldorf
Petri, H. (1997): Guter Vater – Böser Vater. Psychologie der männlichen Identität. Scherz, Bern, München, Wien
Petri, H. (1999): Das Drama der Vaterentbehrung. Chaos der Gefühle – Kräfte der Heilung. Herder, Freiburg
Petri, H. (2002): Das Drama der Vaterentbehrung. Vom Chaos der Familie zu einer neuen Geschlechterdemokratie. In: Frühe Kindheit, Heft 3
Radebold, H. (2000): Abwesende Väter. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen. Vandenhoeck & Rupreccht, Göttingen
Rizzolatti, G. (2008): Empathie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls. edition unseld. Suhrcamp. Frankfurt a/M
Scheer, P.J./Wilken, M. (2002): Zwei sind eineR zu wenig: Die Rolle des Vaters für den Säugling. Psychosozial-Verlag, Gießen
Schorn, A. (2003): Männer im Übergang zur Vaterschaft. Das Entstehen der Beziehung zum Kind. Psychosozial-Verlag, Gießen
Salisch, M. (Hrsg.)(2002): Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend. Kohlhammer, Stuttgart
Saarnie, Carolyn (2002): Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen, in: von Salisch, M.: Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend. Kohlhammer, Stuttgart
Schon, L. (2000): Sehnsucht nach dem Vater. Die Dynamik der Vater-Sohn-Beziehung. Klett-Cotta, Stuttgart
Seiffge Krenke, I. (2002): Väter: Überflüssig, notwendig oder sogar schädlich? In: Psychoanalytische Familientherapie, Nr. 5, Heft II
Stierlin, Helm (1994): Ich und die anderen. Psychotherapie in einer sich wandelnden Gesellschaft. Klett-Cotta, Stuttgart
Streeck-Fischer, A. (2002): Lebensphase Adoleszenz. In: Psychotherapie im Dialog, Zeitschrift für Psychoanalyse, Systemische Therapie und Verhaltenstherapie, 3. Jg., Nr. 4
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 27.02.2012
von Klitzing, K. (2002a): Repräsentanzen der Vaterschaft. Triadische Fähigkeit und kindliche Entwicklung. In: frühe Kindheit, Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind, Heft 3
von Klitzing, K. (2002b): Jenseits des Bindungsprinzips. In: Steinhardt, K./Datler, W./ Gstach, J. (2002) (Hg.): Die Bedeutung des Vaters in der frühen Kindheit. Psychosozial-Verlag, Gießen
Walter, H. (2002): Männer als Väter. Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie. Psychosozial-Verlag, Gießen
Winnicott, D.W. (1984): Kind, Familie und Umwelt. 4. Auflage. Reinhardt, München
Zoja, L. (2002): Das Verschwinden der Väter. Walter, Düsseldorf
Dr. phil. Karl Gebauer ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Bücher zu Erziehungs- und Bildungsfragen. Mitbegründer und Leiter der Göttinger Kongresse für Erziehung und Bildung. Wichtige Bücher: Kinder brauchen Wurzeln; Kinder brauchen Spielräume; Kinder brauchen Vertrauen; Klug wird niemand von allein. Kinder fördern durch Liebe. Patmos Verlag; Gefühle erkennen- sich in andere einfühlen. Kindheitsmuster Empathie. Ein Bilderbuch.